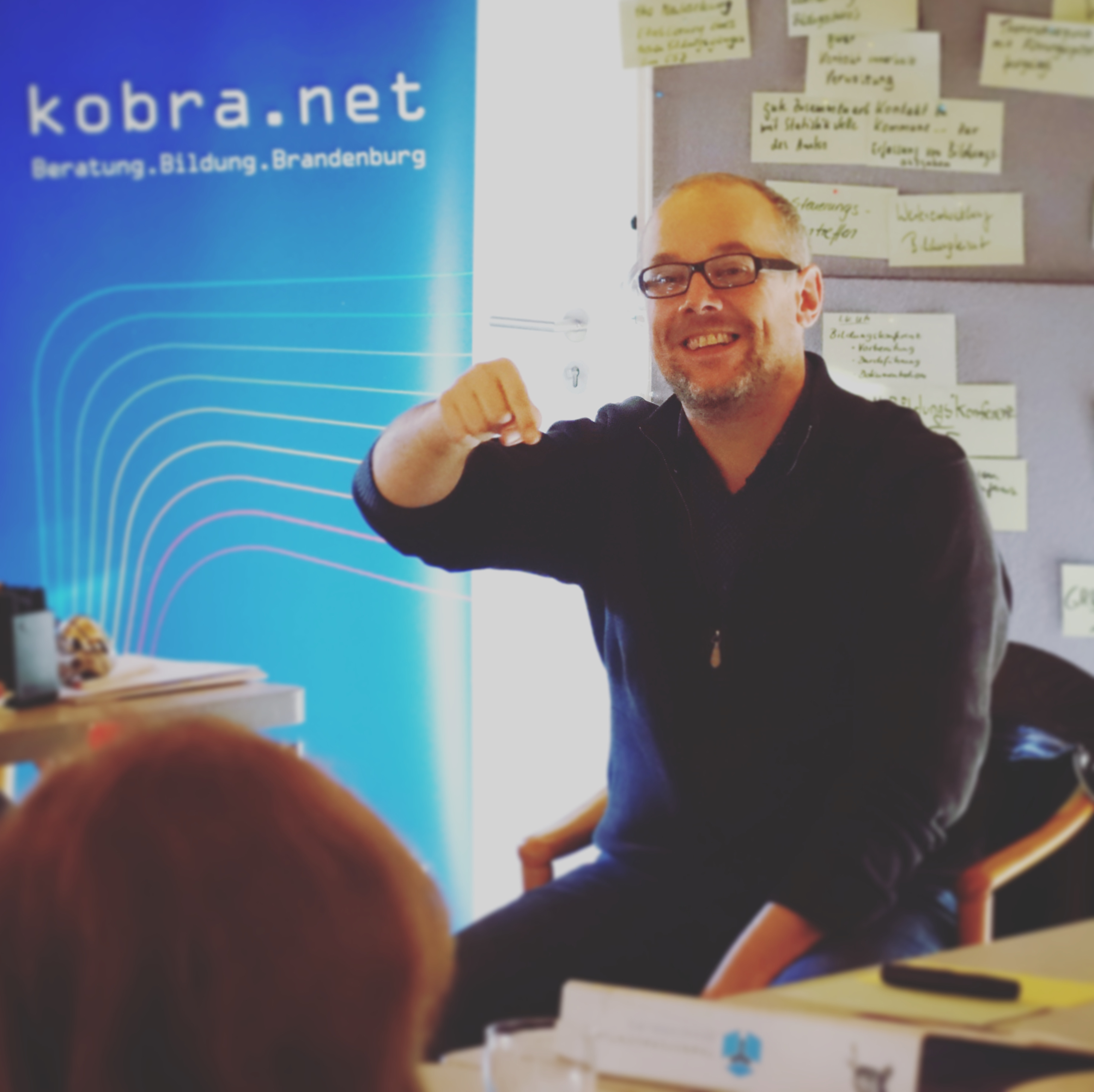Kürzlich hatte ich den Auftrag, für die Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Brandenburg eine Fortbildung zu der Frage durchzuführen, wie sich Kooperation und Prozesse über Abteilungs‑, Behörden- und Gewohnheitsgrenzen hinweg organisieren lassen. Ich bin einem aufgeschlossenen Netzwerk von Spezialisten aus den Bereichen Bildungsmanagement und ‑monitoring begegnet und habe mich sehr über das rege Interesse und den Austausch gefreut. Grund genug, die wichtigsten Punkte der Fortbildung zu einem Artikel zusammenzufassen.
Der folgende Text beantwortet drei Fragen:
- Wie „tickt“ Verwaltung? Indem man Verwaltung als eine spezifische und lange gewachsene Kultur versteht, werden viele Eigenheiten von Behörden verständlich. Gleichzeitig ist es wichtig, mit einigen Missverständnissen und Vorurteilen gegenüber Verwaltungsorganisationen aufzuräumen.
- Wie funktionieren Dialoge, Netzwerke oder gemeinsame Entwicklungen zwischen einzelnen Bereichen derselben Behörde oder zwischen unterschiedlichen Behörden oder zwischen öffentlichen und privaten Organisationen „dennoch“?
- Welche Haltungen und Methoden sind bei der Anbahnung von Zusammenarbeit oder bei der Gestaltung von Netzwerken hilfreich?
Wie „tickt“ Verwaltung?
Wenn man verstehen möchte, wie wir als Menschen „ticken“ oder wie spezifische, von uns geschaffene Organisationsformen funktionieren, ist es hilfreich, an den Anfang zurückzugehen. Ich möchte hier nicht bis an den Anfang der Sprache oder der Kultur überhaupt zurückgehen, das habe ich kürzlich an anderer Stelle auf diesem Blog getan. Wichtig ist hier lediglich, darauf hinzuweisen, was passiert, wenn Menschen beginnen, zusammenzuarbeiten:
- Zunächst gibt es ein Problem, und jemand hat eine Idee.
- Hat die Idee zum Erfolg geführt, wird sie bei ähnlicher Problemlage wiederholt.
- Bei bleibendem Erfolg bilden sich daraus Muster.
- Aus diesen Mustern werden Gewohnheiten.
- Irgendwann bilden diese Gewohnheiten einen „Wert an sich“ und werden an neue Organisationsmitglieder, spätere Generationen usw. weitergegeben.
- Wenn etwas auf diese Weise zum „Besitz der Gruppe“ geworden ist, wird es nicht mehr hinterfragt. Es ist dann selbstverständlich.
Jede Familie besitzt solche Selbstverständlichkeiten, aber auch jede Gruppe, jedes Team, jede Organisation, jede Berufsgruppe, jede Branche, jede Religion, jeder Kulturraum. Um eine über die Zeit bestehende Ansammlung von Menschen zu verstehen, ist es deshalb hilfreich, sich den historischen Prozess der Entstehung ihrer Gewohnheiten anzusehen bzw. aus Beobachtungen zu schließen, welche Annahmen und Regeln jeweils selbstverständlich sind. So gesehen sind die Menschenrechte ein für einen Teil der Welt selbstverständlicher Besitz großer Gruppen, für Menschen aus anderen Teilen der Welt, die zu anderen großen Gruppen gehören, sind die Menschenrechte in ihrer westlichen Ausprägung keineswegs selbstverständlich.
Die in der Verwaltung geltenden Prinzipien sind durch viele Jahrhunderte entstanden. Verwaltung ist zunächst nur ein Herrschaft sichernder bzw. unterstützender Prozess. Im Zuge der Entwicklung unserer Sozialstrukturen wurden Gruppen so groß, dass nicht mehr ein Häuptling allein alles regeln, bestimmen usw. konnte. Es entstanden Mechanismen zur Vertretung des Herrschers in bestimmten Fragen (Verwaltung) und der Sicherung der Herrschaft (Polizei, Militär). Durch viele Versuche, Erfolge und Irrtümer, Neuanfängen auf der Basis bereits bekannter erfolgversprechender Prozeduren oder auch Neuanfängen nach weitgehenden Zerstörungen des Bestehenden haben sich langsam jene Prinzipien herausgebildet, die Max Weber in seinen Studien beobachtet und vermittels Typenbildung zu der von ihm beschriebenen „bürokratischen Herrschaft“ zusammengefasst und von anderen Herrschaftsformen (traditionelle und charismatische Herrschaft) abgegrenzt hat. (Max Weber hat die Prinzipien der bürokratischen Herrschaft nicht behauptet, wie viele Autoren gemeinhin annehmen, sondern er hat Verwaltungsorganisationen beobachtet und die Prinzipien mit Hilfe der Methode der Typenbildung herausgearbeitet (vgl. Morgan 1998).)
Die in der heutigen Verwaltung geltenden Prinzipien lassen sich am Ehesten als „Kontinuität und Korrektheit“ bezeichnen. Verwaltungsorganisationen bestehen deshalb, weil sie auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland demokratisch legitimierte Herrschaft kontinuierlich, korrekt und weitgehend frei von Korruption umsetzen sollen. Dass es sich bei diesen Prinzipien um solche handelt, die der Verwaltung (als Kultur begriffen) zugrunde liegen, wird am Ehesten deutlich, wenn man versucht, die Verwaltung mit Modellen aus anderen „Welten“ zu verändern. In den letzten dreißig Jahren gab es bspw. viele Versuche, Behörden mit aus der Betriebswirtschaftslehre stammenden Instrumenten zu verändern. Im Management geht man von Machbarkeits- und Effizienzgedanken aus. In der Verwaltung geht es aber um Korrektheit und Kontinuität. Daraus entstehen Konflikte, die das Funktionieren der management-inspirierten Methoden wie Zielvereinbarungen, Kennzahlen usw. begrenzen. Besonders deutlich wird dies etwa in Jobcentern, wo einerseits mit entsprechenden Kennzahlen versehene „Aktivierungsquoten“ erfüllt werden, die entsprechenden „Maßnahmen“ aber rechtlich korrekt vergeben und umgesetzt werden sollen — und das mit Hilfe beraterischer und pädagogischer Methoden für Menschen in komplizierten Lebenssituationen. Hier treffen kaum vereinbare Selbstverständlichkeiten aus drei Welten aufeinander: die Korrektheit aus der Behördenwelt, die Zielorientierung mit ihren Kennzahlen aus dem Management und das Verständnis für schwierige Lebenslagen und der Ansatz an den Entwicklungspotentialen von Menschen aus der Pädagogik bzw. der Psychologie. Das schafft Spannungen, oft auch widersprüchliche Situationen, die u.a. zu vergleichsweise hohen psychischen Belastungen bei Teilen der Mitarbeiterschaft führen. Eine ähnliche Situation lässt sich in den Allgemeinen Sozialen Diensten (ASD) vieler Jugendämter beobachten.
Abschließend soll anhand zweier recht verbreiteter stereotyper Annahmen über Verwaltungsorganisationen deutlich gemacht werden, dass Verwaltung oft anders funktioniert, als gemeinhin angenommen wird:
These: „Verwaltung ist per se veränderungsfeindlich.“ Diese oft zitierte Vorstellung stimmt bei genauerem Hinsehen nicht. Zwar gehen Veränderungen in der Verwaltung langsamer vonstatten als in anderen Branchen — zunächst wahrscheinlich weil die rechtlichen Rahmenbedingungen und der bisweilen hohe Grad der Formalisierung eine langsamere Veränderung bedingen, zum anderen aber auch weil sich die handelnden Personen an die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Formalisierung gewöhnen. Bei genauerer Betrachtung über längere Zeiträume hinweg wird aber deutlich, dass Veränderungen zwar langsam vonstatten gehen, aber oft sehr tiefgreifend sind. Die folgende Abbildung zeigt die populärsten Denkmodelle über die öffentliche Verwaltung während der vergangenen etwa 120 Jahre.
Abbildung 1: Die Geschichte des Denkens über Verwaltung während der vergangenen etwa 120 Jahre; Quelle: Heidig, J. (2011). Prozessorientierung als Personalaufgabe. In: Forum Wirtschaftsethik. Nr. 3+4/2011, S. 47; Abbildung: eigene Darstellung
These: „Verwaltung lässt sich durch betriebswirtschaftlich oder postmodernistisch inspirierte Modelle einfach reformieren.“ Aus einer auf eine konkrete Behörde gerichteten Perspektive mögen Veränderungen sehr langsam vonstatten gehen. Aus einer allgemeineren, längere Zeiträume umfassende Perspektive erscheinen Veränderungen hingegen sehr tiefgreifend. Gleichzeitig gilt, dass Veränderungsimpulse in der Regel von außen an die Verwaltung herangetragen werden, in ihrer Wirkung aber selbst auf sehr lange Sicht hin begrenzt bleiben. Die bürokratischen Organisationsprinzipien weisen ein erstaunliches Beharrungsvermögen auf, sodass nach meinem Dafürhalten das folgende Modell die Veränderung der Verwaltung am besten beschreibt:
Abbildung 2: Stark vereinfachter Zusammenhang zwischen Organisationsprinzipien (Kern) und Veränderungsbemühungen (umlaufend); Quelle der Abbildung: Heidig, J. (2018). Proaktive Handlungen in der öffentlichen Verwaltung. Görlitz: Lausitzer Verlag für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Bei Verwaltungsreformen handelt es sich letztlich um eine langsame Infragestellung der Organisationsprinzipien der Verwaltung mit Hilfe von Prinzipien aus anderen „Welten“. Dieser Vorgang lässt sich als eine Art sich um den Kern aus Prinzipien herum wälzenden Interaktionsprozess vorstellen: Führungskräfte und Mitarbeiter nehmen Impulse auf, starten vielleicht neue Handlungsversuche. Manches gelingt, anderes wird verworfen, manchmal aus Gewohnheit, manchmal aufgrund rechtlicher Begrenzungen oder Bedenken. Dabei beeinflussen die geltenden Prinzipien die Interaktion, und die Interaktion beeinflusst, wenn auch langsam, die geltenden Prinzipien.
Wie funktionieren Dialoge, Netzwerke, gemeinsame Entwicklungen „dennoch“?
Nachdem wir gesehen haben, wie die Organisationsprinzipien von Verwaltungsorganisationen entstanden sind und wie sie sich — zwar langsamer als in anderen Branchen, aber wenn, dann auf lange Sicht mitunter recht tiefgreifend — durch Interaktion verändern (für eine ausführlichere Darstellung dieser Prozesse siehe diesen Text), sollen nun einige aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen an und in Verwaltungsorganisationen diskutiert werden. Auch und besonders Verwaltungsorganisationen kommen nicht umhin, sich auf „größere“ Entwicklungen einzustellen. Exemplarisch seien hier nur einige große Entwicklungen und Trends benannt: Digitalisierung, Beschleunigung von Abläufen bei gleichzeitig zunehmender Komplexität, Veränderungen der Akzeptanz von Verwaltungsentscheidungen (zunehmende Hinterfragung) bzw. Veränderung der Rolle von Verwaltung weg von „institutionalisierter Autorität“ hin zum „hinterfragbaren Mitgestalter“ (zumindest in den Augen vieler Akteure), zunehmende Politikverdrossenheit, demographische Entwicklung. Manche fordern gar, Verwaltung solle zum „Partner“ in relativ komplexen Entwicklungen werden oder manche Prozesse gar „proaktiv“ gestalten oder moderieren. Aber Verwaltung darf eigentlich nicht gestalten; eine „proaktive“ Verwaltung ist im eigentlichen Sinne des Wortes „illegal“. Hingegen können Verwaltungsangehörige proaktiv handeln. Verwaltungsangehörige können bestehende Handlungs- und Entscheidungsspielräume entweder „defensiv“ bzw. formalistisch oder „proaktiv“ im Sinne der Ziele von Anträgen, Projekten, Kooperationsvorhaben usw. auslegen. Die oben nur aufgezählten Trends führen ja dazu, dass bspw. Großprojekte kaum noch realisierbar sind ohne mitunter jahrelange Hinterfragungen durch Bürgerinitiativen, Verwaltungsinstanzen o.ä. Gleichzeitig sind viele Probleme und Projekte nur dann zu bewältigen, wenn mehrere Behörden, politische Gremien, öffentliche und private Unternehmen eng zusammenarbeiten. Aktionistisches oder autoritäres „Durchregeln“ führt dabei selten zum Ziel; was es eher braucht, sind klare Ziele und die Fähigkeit der handelnden Personen, über Abteilungs‑, Organisations- und Gewohnheitsgrenzen hinweg miteinander zu arbeiten. Das folgende Modell zeigt, wie diese „proaktive Haltung“ der handelnden Personen befördert werden kann.
Abbildung 3: Der „Möglichkeitsraum“ für proaktive Handlungen; Quelle: Heidig, J. (2018). Proaktive Handlungen in der öffentlichen Verwaltung. Görlitz: Lausitzer Verlag für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; Abbildung: eigene Darstellung
Auf die Frage, was passieren müsste, damit sich Verwaltungsmitarbeiter und ‑führungskräfte in den Organisationen, für die sie tätig sind, einbringen und engagieren, offen für Veränderungen bleiben und Ideen äußern, antworten die meisten mit einer Variante eines Satzes. Dieser Satz lautet: Es kommt darauf an, ob ich den notwendigen Rückhalt habe oder nicht. Zugespitzt ließe sich das so formulieren: Es kommt auf die Beziehung zum Vorgesetzten an. Dieser Zusammenhang scheint unabhängig von der Persönlichkeit, der Hierarchieebene und der Art der Organisation zu sein. Im Grunde genommen lassen sich in Organisationen vier verschiedene individuelle Handlungsmuster beobachten. Das heißt, die Handlungen jeder Führungskraft und jedes Mitarbeiters lassen sich zu einem gegebenen Zeitpunkt einem dieser vier Muster zuordnen:
- Formale Handlungsorientierung: Folgt ein Organisationsmitglied kritiklos allen Organisationsprinzipien, so können wir von Dienst nach Vorschrift sprechen. Dieses Organisationsmitglied fügt sich in seine Rolle und stellt nichts in Frage. Handlungen erfolgen eher abwartend und auf Impulse der Führungskraft hin. Das heißt nicht, dass so handelnde Menschen keine Ideen haben, sie werden sie nur entweder nicht oder erst nach Aufforderung äußern. Mit „Dienst nach Vorschrift“ geht in der Regel eine starke Orientierung an „Blaupausen“ einher, und nicht selten ist diesen Menschen eine gewisse Beständigkeit und Sicherheit wichtig. Gibt es von Vorgesetzten keinen Rückhalt, so gibt es zumindest klar umrissene Aufgaben, an die sich die so handelnden Personen halten können. Fehlen jedoch klare Rollenbeschreibungen oder Vorgaben, kann dies zu Orientierungslosigkeit führen.
- Akzeptiert ein Organisationsmitglied hingegen zwar die Organisationsprinzipien im Kern, stellt aber ansonsten gewisse Prozeduren oder Regeln in Frage und macht diesbezüglich Verbesserungsvorschläge, so können wir von einem proaktiven Handlungsmuster sprechen. Diese Personen werden sich einbringen, Ideen entwickeln, Vorschläge unterbreiten usw.
- Aus einer proaktiven Handlungsorientierung kann mit der Zeit eine Haltung werden, die sich als „pragmatisch“ oder „situationsadäquat-flexibel“ beschreiben ließe. Diese Menschen schätzen ein, wann es sich lohnt, Vorschläge zu machen oder sich zu engagieren, oder wann sie sich mit einer Initiative „verkämpfen“ würden.
- Stellt ein Organisationsmitglied mehr oder minder alles in Frage, so lässt sich das am Ehesten als Opposition oder „Rebellentum“ bezeichnen.
Welches Handlungsmuster eine Person wählt, ist, so zeigen unsere eigenen Forschungen deutlich, weniger von der Persönlichkeit der handelnden Person abhängig, als vielmehr von der Art der Beziehungen zu Vorgesetzten und von den Spielräumen, die das Umfeld der jeweiligen Organisation der handelnden Person bietet. So kann sich etwa jemand, der von sich aus zu Eigeninitiative neigt, mit entsprechendem Rückhalt und bei vorhandenen Spielräumen durchaus entfalten. Trifft jemand mit einer solchen Handlungsorientierung hingegen auf ein eher restriktives Umfeld und verspürt kaum oder keinen Rückhalt „von oben“, so kann sich die vorhandene Eigeninitiative nicht entfalten. Eine solche Situation kann sich in zwei Richtungen entwickeln — entweder, die Person zeigt weiterhin Eigeninitiative, was zwangsläufig zu Konflikten führen wird, oder die betreffende Person passt sich zunächst an, beobachtet und entscheidet später im Einzelfall, wann sich Engagement lohnt bzw. wann es ggf. besser ist, das Muster „Dienst nach Vorschrift“ zu wählen (was dem oben beschriebenen „abwartend-pragmatischen“ Handlungsmuster entspricht).
Die Beziehungsarten noch einmal im Detail:
- Formalistische Beziehung: In diesem Fall betont die Führungskraft die Sachebene, gibt Mitarbeitern kaum Rückhalt und blendet die „menschlichen Faktoren“ weitgehend aus („Wir sind hier nicht auf dem Ponyhof!“). Manche formalistisch orientierte Führungskräfte zögern nicht, bei Problemen mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu drohen oder sagen Sätze wie: „Wenn Sie glauben, dass es woanders schöner ist, halte ich Ihnen gern die Tür auf.“
- Lernorientierte Beziehung: Aus Sicht vieler von mir befragter Personen (unabhängig davon, ob in Mitarbeiter- oder Führungspositionen) ist die beste Voraussetzung für engagiertes, motiviertes und idealerweise „proaktives“ Handeln der Rückhalt durch die direkt vorgesetzte Person. Ist Vertrauen in die Führungskraft vorhanden, ermöglicht das Eigeninitiative. Weiß man hingegen nicht, woran man ist, schränkt das die Eigeninitiative ein, und man macht auf lange Sicht eher „Dienst nach Vorschrift“.
- Pragmatische Beziehung: Wer bereits länger im Unternehmensgeschehen tätig war, weiß genau, bei welchen Führungskräften „Mitdenken erwünscht“ ist und bei welchen nicht. Viele Mitarbeiter überlegen sich deshalb mit der Zeit, wann sie sich einbringen oder nicht. Sie haben gelernt, dass man sich auch „verkämpfen“ kann. In Führungspositionen führt diese Einstellung oft zu einer Haltung, die man als „sachbezogenen Rückhalt“ bezeichnen könnte. Während im Falle der lernorientierten Beziehung der Rückhalt und das Interesse sach- und personenbezogen sind, erhält man im Falle der pragmatischen Beziehung zwar alle sachlich notwendigen Mandate und die entsprechende Unterstützung, muss aber auftretende Probleme und Konflikte weitgehend selbst lösen. Wer im Unternehmen „pragmatisch sozialisiert“ wurde, hatte es nicht leicht, wurde dadurch aber in der Regel „fester“ oder „beständiger“, was das eigene Durchhaltevermögen betrifft — oder ist beizeiten wieder gegangen.
- Oppositionelle/rebellische Beziehung: Trifft eine Person, die Eigeninitiative zeigen möchte und sich kritisch mit den vorhandenen Routinen auseinandersetzen will (oder oft auch soll), auf eine Führungskraft, die eher formalistisch führt und kein Interesse an den Ideen der neuen Mitarbeiterin hat und den Status quo in keiner Weise ändern möchte, dann führt das mit der Zeit zu etwas, das sich als „rebellische“ Beziehung zur vorgesetzten Person bezeichnen ließe.
Das oben dargestellte Modell basiert auf einer Reihe von Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern aus Verwaltungsorganisationen. Eine ausführlichere Erläuterung des Modells finden Sie in meinem Buch „Proaktive Handlungen in der öffentlichen Verwaltung“. Da Forschungsergebnisse, die auf Beobachtungen oder Interviews beruhen, oft hinsichtlich ihrer Gültigkeit und Verallgemeinerbarkeit hinterfragt werden, wurde das Modell einer empirischen Überprüfung unterzogen. Bereits während der Erarbeitung des Modells war deutlich geworden, dass die Aussagen des Modells nicht nur auf die öffentliche Verwaltung, sondern auch auf alle anderen Branchen, also Organisationen im Allgemeinen, zutreffen. Die folgenden beiden Grafiken stammen aus einer größeren Studie zu Themen wie Mitarbeiterbindung und Führung aus dem Jahr 2018. In der Untersuchung wurden insgesamt 1351 Personen zwischen 16 und 67 Jahren befragt (Quotenstichprobe nach Alter und Geschlecht). Die hier dargestellten Ergebnisse sind branchenübergreifend für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen repräsentativ.
Abbildung 4: Der Zusammenhang zwischen der Art der Beziehung zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem und der Bereitschaft des Mitarbeiters, sein Unternehmen weiterzuempfehlen; Benchmark über alle Branchen: Im Schnitt sind 26 Prozent der Befragten bereit, ihre Organisation bzw. ihren Arbeitgeber weiterzuempfehlen; etwa die Hälfte aller Arbeitnehmer ist kritisch eingestellt. Aus der Abbildung geht deutlich hervor, dass insbesondere der Anteil derer, die aktiv schlecht über ihren Arbeitgeber sprechen, stark von der Qualität der Beziehung zum Vorgesetzten beeinflusst wird (31 Prozent Kritiker im Falle einer lernorientierten Beziehung vs. 65 Prozent Kritiker im Falle einer rebellischen Beziehung). Quelle: MAS-Mitarbeiterstudie Mitteldeutschland
Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen der Art der Beziehung zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem und dem Wechselwillen des Mitarbeiters; Benchmark über alle Branchen: 27 Prozent aller Arbeitnehmer geben an, ihren Arbeitgeber in den kommenden zwei Jahren sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich aus eigenem Antrieb zu wechseln. Die Art der Beziehung zum Vorgesetzten kann diese Bereitschaft senken (lernorientierte Beziehung) oder erhöhen (oppositionelle/rebellische Beziehung). Sowohl im Falle der pragmatischen als auch der formalistischen Beziehung bleibt die Jobwechselwahrscheinlichkeit nahe dem Durchschnitt über alle Branchen. Quelle: MAS-Mitarbeiterstudie Mitteldeutschland
Zusammenfassung zur zweiten Frage: Wie Verwaltungsmitarbeiter handeln, ist vor allem eine Frage der Beziehungen zu vorgesetzten Personen. Natürlich fließen die Wirkungen früherer Sozialisationsprozesse und Persönlichkeitsfaktoren ein, aber die Beziehungen zu Vorgesetzten geben den Ausschlag, ob und wie sich proaktive Handlungstendenzen entfalten können. Zu einer solchen Entfaltung bedarf es im Sinne einer Minimalanforderung mindestens sachbezogenen Rückhalts durch mindestens eine vorgesetzte Person. Das würde zumindest die Ausprägung einer abwartend-abwägenden bzw. abwägend-strategischen Handlungstendenz ermö̈glichen. Ist die Minimalanforderung nicht gegeben, kö̈nnen sich proaktive Handlungstendenzen nicht entfalten und es bleibt bei abwartend-angepassten Handlungsmustern verbunden mit dem Wunsch, proaktiv zu handeln, aber ohne die Wahrnehmung einer Möglichkeit dazu, oder es kommt – bei ohnehin stark ausgprägten proaktiven Handlungstendenzen – zu einer teufelskreisartig eskalierenden Beziehungsdynamik, die zum „Umschlagen“ der proaktiven Handlungsmuster in Opposition führen kann. Die zentrale Einflussgröße ist also die Führungshaltung des direkten Vorgesetzten bzw. dessen Kompetenz, die Beziehungen zu seinen nachgeordneten Führungskräften bzw. Mitarbeitern so zu gestalten, dass diese Rückhalt verspüren und bereit sind, Ideen einzubringen und Veränderungen umzusetzen. Dabei kann man einen pragmatischen „Rückhalt in der Sache“ (Delegation von Aufgaben, Übertragung von Verantwortung) von einem „personenbezogenen Rückhalt“ unterscheiden. Letzterer ist von Interesse an Mitarbeitern und von persönlicher Unterstützung im Bedarfsfall geprägt. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn beide Führungshaltungen (Rückhalt in der Sache und personenbezogener Rückhalt) zusammenkommen. Die schlechteste Wirkung auf die Handlungsorientierung der Mitarbeiter haben Führungskräfte, die nur „formalistisch“ führen, d.h. vergleichsweise strikt auf „Dienst nach Vorschrift“ beharren.
Welche Haltungen und Methoden sind hilfreich?
Wir hatten eingangs bereits festgestellt, dass es gegenwärtig zahlreiche Herausforderungen gibt, die eine stärkere Zusammenarbeit bzw. Vernetzung über Abteilungs‑, Organisations- und Gewohnheitsgrenzen hinweg erfordern. Will man die gegenwärtigen Herausforderungen und den Weg zu ihrer Bewältigung in eine einfache Formel bringen, so wird man bei Edgar Schein fündig:
Abbildung 6: Eine vorurteilsarme, interessierte Haltung und entsprechende Fragetechniken führen zu Vertrauen als Grundlage guter Kommunikation; Quelle: Schein, E. H. (2013). Humble Inquiry. San Francisco: Berrett-Koehler; Abbildung in Anlehnung an Pichler, M. (2013). So öffnen sich Menschen. In: wirtschaft + weiterbildung, Nr. 10/2013, S. 19f.; Textfelder der Abbildung sind Zitate
Erhöhte Komplexität (die Folge von Verdichtung und Beschleunigung) erfordert mehr und bessere Kommunikation. Gelingende Kommunikation wiederum hat eine Menge mit tragfähigen Beziehungen zu tun. Damit Informationen – etwa von Mitarbeitern zu ihren Vorgesetzten oder eben über die besagten Abteilungs- oder Gewohnheitsgrenzen hinweg – tatsächlich zur richtigen Zeit weitergegeben werden, bedarf es der Bereitschaft dazu. Es geht darum, sich das Vertrauen der Partnerinnen und Partner zu erarbeiten. Die Frage ist also, wie Vertrauen entsteht.
Vertrauen entsteht durch ehrliches Interesse. Interesse zeigt sich am Ehesten durch die Fähigkeit, offene und interessierte Fragen zu stellen (und weniger selbst mitzuteilen). Das klingt erst einmal ganz einfach, ist es aber nicht. Wir sind derart gewohnt, uns gegenseitig etwas mitzuteilen, dass wir dies nicht hinterfragen – und auch gar nicht merken. „Klar habe ich Interesse an meinen Mitarbeitern.“ sage ich mir und merke gar nicht, dass ich eben nicht frage, sondern eher auf die Erwartung meiner Mitarbeiter reagiere. Ich sei doch der Vorgesetzte, sagen sie, und was ich jetzt auf die Agenda für die Besprechung setzen möchte, fragen sie. Ich könnte den Spieß herumdrehen und Fragen stellen – fragen, wie man hier in diesem Team bisher an Aufgaben herangegangen ist, was lehrreiche Ereignisse waren, wie hier früher geführt wurde, wie man Absprachen getroffen hat, was man beibehalten möchte, was vielleicht verändern, was man von mir als Vorgesetztem erwartet usw. Und wenn man diese Fragen nicht nur am Anfang stellt, sondern auch später, und wenn man auch „neben dem Dienst“ (in den Pausen, in der informellen Phase vor einem Netzwerktreffen bei einem Kaffee) Interesse zeigt, dann werden sich die Mitarbeiter diesem Interesse kaum entziehen können.
Durch Interesse öffnen sich Menschen aber nicht nur, sondern eine interessensgeleitete, fragende Haltung dient auch der Lösung von komplexen Problemen. In der Regel sind Probleme – zumindest die nicht-trivialen, einfach lösbaren – so beschaffen, dass sie sich zunächst einmal sperrig und unzugänglich zeigen. Druck oder „klare Ansagen“ sind in der Regel nicht besonders hilfreich. Was hingegen hilft, sind Änderungen des Blickwinkels, Ideen, Lösungsversuche. Manche gehen sogar soweit zu sagen, dass es angesichts vieler komplexer Lagen gar nicht anders geht, als auszuprobieren und Fehler zu machen. Was ist nun aber besser zum Wechsel des Blickwinkels und zur Entwicklung von Ideen geeignet als ein gutes Gespräch oder offener Austausch? Und wie beginnt ein gutes Gespräch? Ganz bestimmt auch nicht mit einer Ansage, wie „es“ denn nun zu machen sei, sondern mit ein paar offenen Fragen. Und wie beginnt ein gutes Netzwerktreffen? Um die Leute (immer wieder) hinzulocken, braucht es immer ein interessantes Thema oder eine interessante Besichtigung, Vorführung o.ä. Noch wichtiger sind jedoch die Qualität des Essens und die Reihenfolge der Programmpunkte: Austausch sollte vor dem Input kommen. Das „Tragende“ an einem Netzwerk sind die entstehenden Beziehungen. Die Teilnehmer sollten deshalb zunächst Interesse aneinander entwickeln. Veranstaltungen sollten entsprechend „dialogisch“ gestaltet sein. Eine Auswahl von Techniken, die dabei hilfreich sein können:
- ausführliche Vorstellungsrunde
- bei den Workshops jeden Teilnehmer (wenn die Gruppe mehr als acht Personen umfasst, gern auch in Dreiergruppen) erzählen lassen,
- anfangs zu gegenseitigen Fragen auffordern, und zwar nicht mit der Frage, ob es Fragen gibt, sondern wer welche Fragen hat (Anfangs ist dazu die Unterstützung durch Moderatoren notwendig, später wird es Gewohnheit.)
- genügend Zeit für unstrukturierten Austausch („Die Atmosphäre der Kaffeepause zum Prinzip machen“ – nicht für die gesamte Zeit einer Veranstaltung, aber etwa für 1/4 der zur Verfügung stehenden Zeit.)
- geeignete räumliche Bedingungen (Nichts ist unkommunikativer als eine lange Tafel.)
- gutes Catering (Die erinnerte Qualität von Veranstaltungen korreliert vielleicht mit der Qualität eines Vortrags, sicher aber mit der Qualität des Essens.)
Wichtig ist, dass die Teilnehmer nicht nur passiv-reaktiv agieren, sondern von der ersten Minute an aktiv in das Geschehen einbezogen werden. Dafür geeignete Methoden sind bspw.:
- Austausch ermöglichen, u. a. durch genügend Pausen,
- konsequente Orientierung der Inhalte an den Erwartungen der Teilnehmer,
- regelmäßige Erwartungsabfragen,
- Aufforderung zur Formulierung von Fragen,
- „erzählgenerierende“ Fragen am Anfang eines Treffens oder Workshops,
- Referenteneinsatz weniger frontal, sondern mehr dialogisch.
Titelfoto: Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Brandenburg