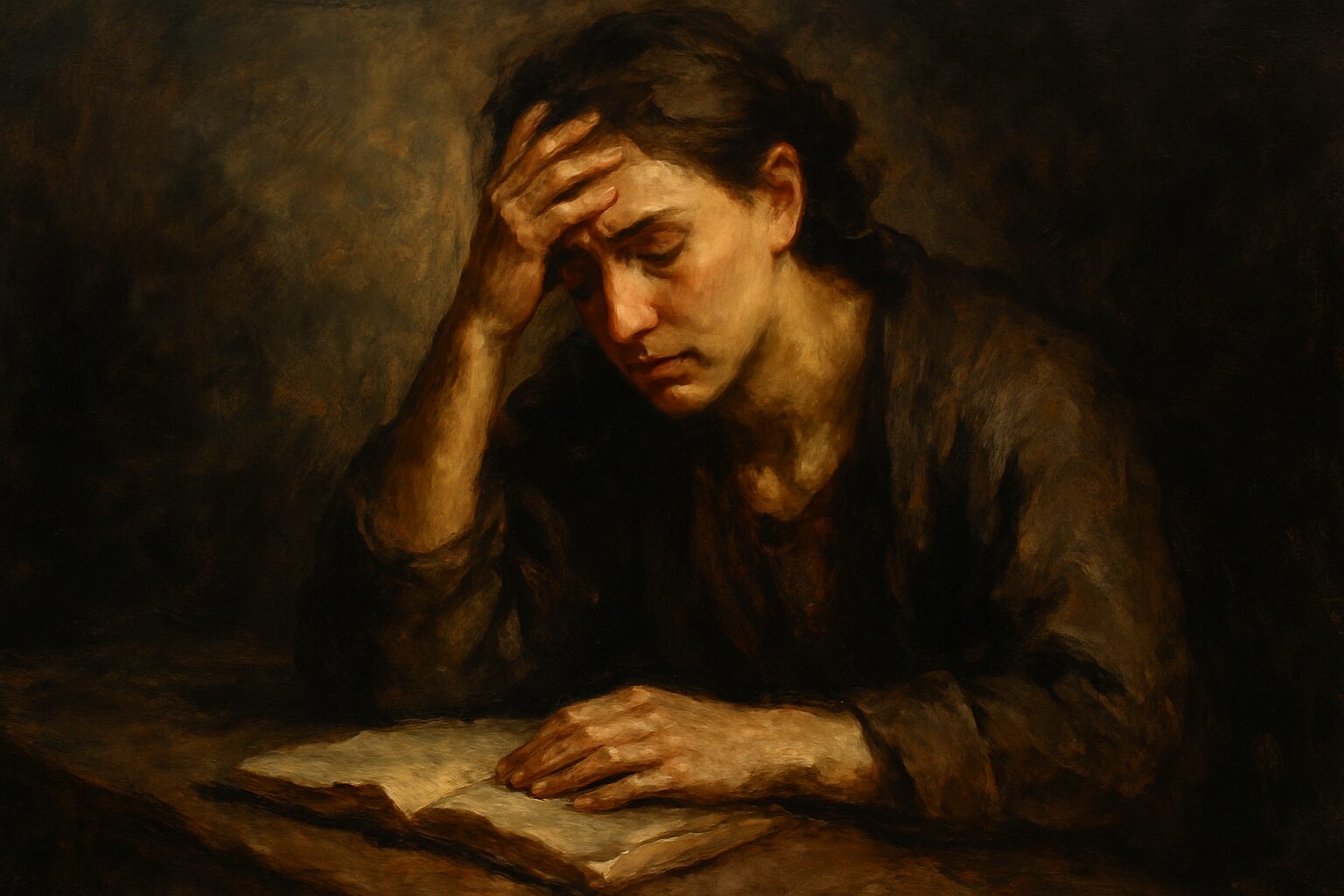Vorwort
Kürzlich hatte ich die Freude, mit dem Team der Innovationsabteilung einer größeren Organisation ein Seminar durchzuführen, in dem es um die Frage ging, wie man mit Druck und Stress umgehen und unter angespannten Bedingungen so kommunizieren kann, dass Ergebnisse erreicht werden können. Das bedeutet natürlich in erster Linie, ebenso ruhig und freundlich wie geduldig und hartnäckig zu bleiben. Wenn das jeweilige Gegenüber mit Ablehnung oder gar Konfrontation oder Abwertung reagiert, werden die entsprechenden Gespräche schnell zur Herausforderung. Die erste Frage lautet also, wie ich ruhig und freundlich bleiben und unnötige Eskalationen verhindern kann.
Gleichzeitig kann man keine Innovationsrolle innehaben, die Wirkung entfaltet, wenn man immer nur deeskalierend vorgeht und ruhig bleibt. Freilich soll man mit Konflikten konstruktiv umgehen. Aber unter Umständen muss man gerade in größeren und älteren Organisationen manche Konflikte überhaupt erst einmal schaffen, damit es etwas zu bearbeiten gibt, sprich: damit Innovation überhaupt erst möglich wird. Die zweite Frage richtet sich also nicht so sehr auf Selbstmanagement (wie die erste Frage), sondern auf wirkungsvolle Selbstbehauptung, und zwar nicht auf das „Selbst“ gerichtet, sondern auf die Zukunft der Organisation. Man macht sich selbst quasi zum Instrument der Weiterentwicklung der Organisation, man will eine gewisse Wirkung erzielen.
In diesem Text geht es um Techniken, die mir helfen, in stressigen oder konfrontativen Situationen handlungsfähig zu bleiben (oder es wieder zu werden). Dieser Text ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie zum Thema Innovation. Der zweite Teil befasst sich mit der Frage, wie man innerhalb der Organisation – auch gegenüber Vorgesetzten – Mut zeigen und Veränderungen vorantreiben kann. Im dritten Teil geht es um die Frage, was man noch machen kann, wenn Argumente an Grenzen gekommen sind.
Vier Techniken zum Umgang mit Druck und Stress
In angespannten Situationen – und davon gibt es in Innovationsabteilungen mehr als genug – entscheidet weniger das perfekte Argument, sondern mehr die Fähigkeit, unter Druck handlungsfähig zu bleiben. Wer Innovationen durchsetzen will, braucht mehr als Überzeugungskraft. Man braucht Zugriff auf den eigenen Zustand, auf sich selbst unter Stress.
Daher beginnt jedes wirkungsvolle Training, das sich ernsthaft mit organisationalem Wandel beschäftigt, nicht bei Techniken der Überzeugung, sondern bei Techniken der Selbstführung.
1. Atmung als Zugang zur Steuerung
Die einfachste Methode — ebenso oft belächelt wie selten geübt: bewusste Atmung. Wer unter Stress steht, atmet flach, unbewusst, hektisch – und schickt damit dem eigenen Nervensystem ein Dauerfeuer an Alarmimpulsen. Wer aber tief in den Bauch atmet, signalisiert dem Körper: Es ist kein Angriff. Es ist nur ein Meeting.
Zwei Varianten haben sich als besonders praxistauglich erwiesen:
- Dreimal tief und bewusst in den Bauch atmen – wenn man das öfter geübt hat, reicht später oft ein einziges Mal, um den gewünschten Zustand zu erreichen. Man wird dann nicht „cool“, aber man kann entspannter reagieren, eine Verstehenspause einlegen, sich die nächste Frage einfallen lassen.
- Die 4–7–8‑Regel: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen – und das fünfmal hintereinander. Probieren Sie das bitte aus und beobachten Sie die Vorgänge im Körper. Wenn man diese Technik regelmäßig übt, lernt man mit der Zeit, sich durch bewusste und methodische Atmung selbst zu beruhigen. In Stresssituationen hat man natürlich nicht die Zeit, 5 x 19 Sekunden Atemübungen durchzuführen. Die Technik funktioniert nicht auf Knopfdruck. Sie muss eingeübt werden, zuhause im Stillen, außerhalb der Drucksituation. Nur dann funktioniert sie auch, wenn es darauf ankommt. Der Körper „erinnert sich“. Ich gehe vor wichtigen, potentiell schwierigen Gesprächen oder anderen potentiell stressauslösenden Situationen zum Beispiel kurz auf die Toilette, führe diese Übung durch und gehe dann gelassener in den entsprechenden Termin.
2. Progressive Muskelentspannung – Der Anspannung etwas entgegensetzen
In manchen Situationen reichen die Atem-Techniken nicht aus. Dann bleibt mir noch der „Umweg über die Muskulatur“ — die progressive Muskelentspannung, eine Technik, die beispielsweise auch Einsatzkräften in hochgradig stressigen Situationen nachweislich hilft. Einzelne Muskelgruppen werden gezielt angespannt und dann bewusst gelöst. Der Körper wird so von der Peripherie her in einen Zustand der Entspannung gebracht – was zu mehr Fokus und Konzentration führt und dabei hilft, handlungsfähig zu bleiben. Man suche nach Trainingsanleitungen im Internet — allerdings wird die klassische Variante häufig im Liegen instruiert. Das hilft am Arbeitsplatz wenig, man kann sich ja in der Regel nicht erst einmal hinlegen. Auch hier gilt: Ich muss die Sache in ruhigen Zeiten einüben, damit die Technik unter Hochdruck funktioniert. Man kann die folgenden Übungen im Sitzen durchführen:
- Hände und Unterarme für 5–7 Sekunden stark anspannen und wieder loslassen.
- Dann die Augen fest verschließen und die Stirn krauß ziehen und die Anspannung ebenfalls für 5–7 Sekunden halten und dann wieder entspannen.
- Dann die Bauchmuskulatur stark anspannen und gleichzeitig den Rücken durchdrücken — ebenfalls für 5–7 Sekunden.
- Dann die Füße stark auf den Boden drücken und die Oberschenkel anspannen — und wiederum nach 5–7 Sekunden lockerlassen.
- Alle genannten Muskelgruppen zusammen für 5–7 Sekunden anspannen und wieder lockerlassen.
Wenn Sie das einmal probieren, spüren Sie bitte nach, wie sich Ihr Körper nach einem vollständigen Zyklus anfühlt. Auch hier geht es darum, die Technik regelmäßig zu trainieren. Wenn man seinem Körper „beigebracht“ hat, sich auf Kommando anzuspannen und zu entspannen, reicht im Bedarfsfall in der Praxis oft schon eine subtile Variante: Fäuste und Unterarme unter dem Tisch anspannen, kurz halten, lösen. Ein paar Sekunden Konzentration auf die eigene Körperspannung reichen oft, um sich wieder zu fokussieren, den Verstand wieder in Gang zu setzen, sich die nächste Frage oder Antwort einfallen zu lassen o.ä. – nur eben nicht „automatisch“ in die nächste Eskalationsstufe zu rutschen.
3. Die Ankertechnik – Entspannung auf Abruf
Klingt esoterisch, ist es aber nicht. Die Ankertechnik ist nichts anderes als klassische Konditionierung – ein gespeicherter Zustand auf ein selbstgewähltes Signal hin. Man setzt sich in Ruhe hin, schließt die Augen, erinnert sich an einen besonders klaren, positiven, vielleicht glücklichen Moment. Einen, in dem der Körper ruhig war, der Kopf frei, die Welt nicht feindlich. Man lässt den Moment kommen. Wenn es gelingt und der Moment präsent wird, dann spürt man dem nach, geht gleichsam in dem Moment „spazieren“: Man fühlt, was es zu empfinden gab: Wie war die Empfindung auf der Haut? Was war zu sehen? Was war zu hören? Wonach roch es vielleicht? Und wenn der Moment so richtig „da“ ist, dann verknüpft man diesen Zustand mit einem Signal: ein „Zauberwort“, eine Geste, ein inneres Bild. Wichtig ist, diese Übung zu wiederholen. Zweimal täglich. Zwei Wochen lang.
Wer das durchhält, kann später in einer Eskalationssituation – in einem schwierigen Gespräch, bei einer harten Rückmeldung oder auch in einer Präsentation vor vielen Menschen – das Signal anwenden und erleben, wie sich die Atmung beruhigt, man vielleicht sogar lächeln kann, wie sich Klarheit einstellt und der Fokus zurückkommt. Das macht einen wie gesagt nicht „cool“, aber es macht ruhiger. Und es bringt einen wieder ins Handeln.
4. Reframing – Der emotionale Reset
Die vierte Technik ist kognitiv. Sie richtet sich an jene, die sich nicht mit Atmung oder Körperarbeit anfreunden können oder wollen, sondern gleichsam denken müssen, um Gefühle in den Griff zu bekommen („Kopfmenschen“). Reframing bedeutet: Gefühle in Sprache zu überführen – und dann die Sprache (und damit auch die Gefühle) zu verändern.
Erster Schritt: Man schreibt die emotional gefärbten Gedanken auf, so wie sie kommen: roh, emotional, überzeichnet.
Beispiele:
„Warum ist der wieder so herablassend?“
„Warum stellt sie meine Kompetenz in Frage?“
„Warum lehnt er alles ab, was wir tun?“
Zweiter Schritt: Dann zieht man einen Strich. Und darunter schreibt man dieselbe Reaktion oder Beobachtung ohne emotionale Aufladung auf:
„Die Führungskraft hat mein Konzept abgelehnt.“
„Mein Vorschlag wurde nicht angenommen.“
„Mein Gegenüber hat eine andere Meinung als ich.“
Dieser Übergang vom Affekt zur Beschreibung ist kein Selbstbetrug. Er ist ein Weg zurück zur Handlungsmöglichkeit. Wer beschreibt, hat wieder Kontrolle. Wer wütend ist, reagiert automatisch (im Zweifel emotional, eskalierend). Wer schreibt und dabei umdeutet, holt sich die Kontrolle zurück.
Nicht jede Methode ist für jede oder jeden
Es wäre falsch, diese Techniken als Standardlösungen für alle Menschen und für alle Anwendungsfälle zu verkaufen. Menschen sind unterschiedlich, Organisationen und Situationen auch. Nicht jeder kann mit Reframing arbeiten. Nicht jede will den glücklichsten Moment ihres Lebens heraufbeschwören. Und nicht jeder hat die Geduld, sich Atemtechniken oder Progressive Muskelentspannung beizubringen. Man kann wählen und probieren, was zu einem passt und im eigenen Anwendungsbereich funktioniert.
Alle Techniken haben einen gemeinsamen Zweck: Handlungsfähigkeit unter Belastung zu sichern. Nicht, um Recht zu behalten. Nicht, um sich zu profilieren. Sondern um der eigenen Überzeugung einen Körper zu geben, der sprechen kann, ohne zu zittern.
PS: Das Beitragsbild wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.